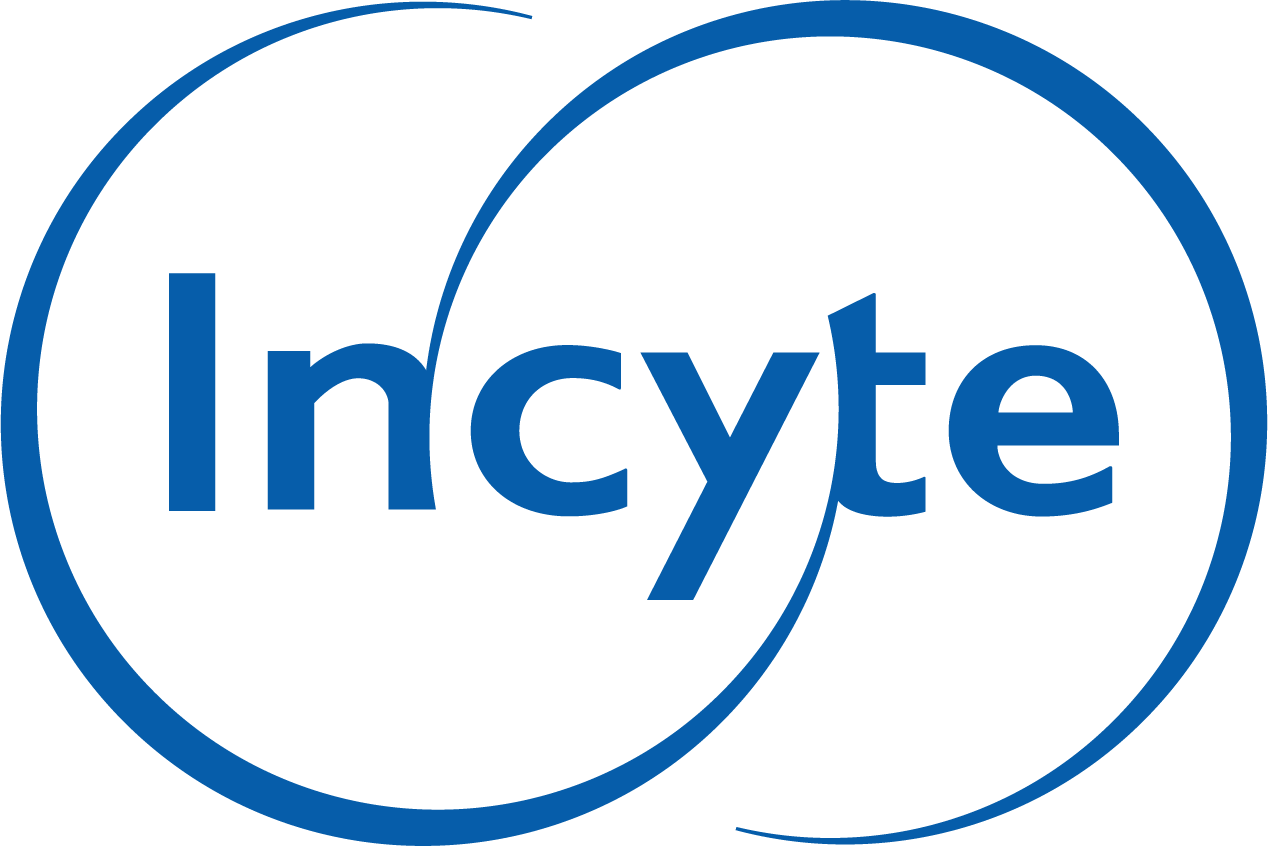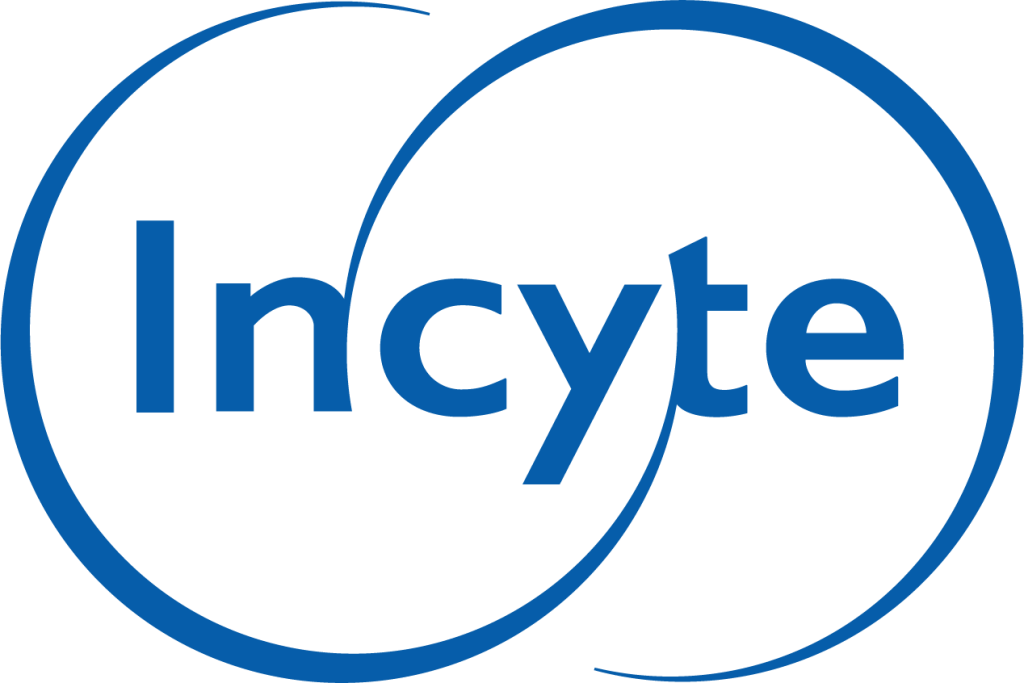Die Erkenntnis setzt sich immer mehr durch: Vitiligo, auch Weißfleckenkrankheit genannt, ist kein oberflächliches Hautproblem, sondern eine ernstzunehmende Autoimmunerkrankung. Mehr noch: Vitiligo-Patienten haben sogar ein erhöhtes Risiko, weitere Autoimmunerkrankungen zu entwickeln.
Die Medizin kennt zwischen 80 und 100 verschiedene Autoimmunerkrankungen, von denen etwa die Hälfte selten vorkommt. Allen Autoimmunerkrankungen gemeinsam ist die Entwicklung chronischer Entzündungsprozesse, die sich gegen sich selbst (auto) richten, also gegen körpereigene Zellen. Bei der Vitiligo werden die pigmentbildenden Zellen der Haut, die Melanozyten, von der körpereigenen Abwehr als Fremdkörper angesehen und zerstört. Die Folge: In den betroffenen Hautarealen fehlt der Farbstoff Melanin, es entstehen weiße Flecken.
Immunsystem außer Kontrolle
Ein gesundes Immunsystem kann zwischen körpereigenen Zellen und Fremdstoffen wie Viren, Bakterien, Parasiten und Umweltschadstoffen unterscheiden. Die Abwehrzellen des Immunsystems werden dann gezielt gegen die Eindringlinge mobilisiert. Bei einer Autoimmunerkrankung wendet sich das Immunsystems gegen körpereigene Zellen wodurch körpereigenes Gewebe beschädigt oder teilweise ganz zerstört wird.
Erhöhtes Risiko für Begleiterkrankungen
Bei der Entstehung einer Autoimmunerkrankung spielen genetische Faktoren eine wichtige Rolle. Zwischen 5 und 20 Prozent der Menschen, die an der Weißfleckenkrankheit leiden, haben Verwandte, die ebenfalls an Vitiligo erkrankt sind. Besondere genetische Merkmale von Vitiligo-Betroffenen weisen zudem auf eine erhöhte Neigung zu weiteren Autoimmunerkrankungen hin. Dabei wurden so genannte Empfänglichkeits-Gene identifiziert, die an wichtigen Signalwegen der Immunregulation beteiligt sind. Das Risiko, eine andere Autoimmunerkrankung zu entwickeln, ist bei Menschen mit Vitiligo 2,5-mal höher als bei Menschen ohne Vitiligo.
Schilddrüsenerkrankungen häufig
Die Wahrscheinlichkeit, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse zu erwerben, ist mit knapp 15 Prozent besonders hoch. Beim so genannten Morbus Hashimoto führt der autoimmune Entzündungsprozess zu einer Unterfunktion der Schilddrüse. In ihrer Leitlinie zur Therapie und Diagnostik der Vitiligo empfehlen die Experten daher, den TSH-Wert bei Vitiligo mindestens einmal jährlich zu kontrollieren. Das TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) löst die Ausschüttung wichtiger Schilddrüsenhormone aus und ist ein entscheidender Wert, um Fehlfunktionen zu erkennen. Regelmäßige Kontrollen sind wichtig, da die Schilddrüsenhormone lebenswichtige Organe beeinflussen und unter anderem an der Regulation der Gehirnfunktion, des Herz-Kreislauf-Systems und der Fortpflanzungsfähigkeit beteiligt sind.
Zu den Autoimmunerkrankungen, die mit Vitiligo in Verbindung gebracht werden, gehören:
- Hashimoto-Thyreoiditis: Eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die zu einer Unterfunktion führt.
- Psoriasis (Schuppenflechte): Eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Haut angreift, was zu Entzündungen und Schuppenbildung führt.
- Alopecia areata: Autoimmunerkrankung, die zu kreisrundem Haarausfall führt.
- Diabetes Typ 1: Eine Form von Diabetes, bei der das Immunsystem die Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört.
- Systemischer Lupus erythematodes: Eine Autoimmunerkrankung, die zu einer Entzündungsreaktion in verschiedenen Organen führt und Gewebe wie Haut, Gelenke, Nieren, Herz, Lunge und das zentrale Nervensystem betreffen kann.
- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn.
- Fehlfunktionen der Augen und des Innenohres.
Was Vitiligo-Patienten beachten sollten
Da weitere Autoimmunerkrankungen auftreten können, ist es wichtig, bei Vitiligo nicht nur auf die Hautveränderungen zu achten, sondern den gesamten Gesundheitszustand im Auge zu behalten. Auch wenn Betroffene ihre Vitiligo nicht behandeln lassen wollen, sollten sie regelmäßige ärztliche Kontrollen in Betracht ziehen.
- Regelmäßig zum Arzt gehen: Insbesondere bei Symptomen wie Müdigkeit, Haarausfall, Gelenkschmerzen oder unerklärlicher Gewichtszunahme oder -abnahme.
- Gesunde Lebensweise: Stressabbau, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf können helfen, das Immunsystem zu stabilisieren.
- Auf Veränderungen achten: Treten neue Beschwerden auf, sollte frühzeitig ein Arzt aufgesucht werden.
Fazit: Die Krankheit ernst nehmen, aber keine Angst haben
Vitiligo ist mehr als eine kosmetische Herausforderung – es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, die weitere gesundheitliche Folgen haben kann. Dennoch besteht kein Grund zur Panik. Wer seine Gesundheit regelmäßig überprüft, auf seinen Körper achtet und bei neuen Beschwerden zum Arzt geht, kann mögliche Begleiterkrankungen frühzeitig erkennen und behandeln. Eine gute medizinische
Betreuung kann helfen, langfristige gesundheitliche Probleme zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern.